On Saturday 13 July 2024, the workshop „Safe(r) Space for Queer Muslims – Connecting and Empowering“ took place with a focus on networking and empowering queer Muslim people. The workshop was organised by a former participant of DialoguePerspectives Atahan Demirel.
Impressions and insights from the workshop:
It is important that queer Muslims have a place where they can network and get support from like-minded people. Queer Muslim people often do not have a community where they can be free from discrimination. In addition to discrimination in so-called mainstream German society, they also experience anti-Muslim racism in some queer communities and queerphobia in some Muslim circles. This project and workshop aimed to alleviate this situation through networking and empowerment work and, in the best case, to pave the way for the creation of a sustainable community.
For the workshop, the speaker prepared various measures that were tailored to the needs and concerns of queer-Muslim people. The aim of the workshop was to build confidence, promote sharing and networking, as well as healing in a supportive community and planning for the future. After a welcome and introduction, there were exercises to find and strengthen identity, with many personal experiences shared in a diversity-sensitive way. This was followed by community building exercises, some of which focused on finding a common vision.
In addition to the speaker and the project manager, ten participants took part in the workshop, all of whom identified as queer-Muslim. During the event, it quickly became clear that the discrimination experienced had left many traumas and that collective healing was made possible as part of the development of the exercises. Through sharing, it quickly became clear that there were similarities and parallels in the discrimination experienced. This realisation was a form of healing for everyone as it became explicit that those involved were not alone with their problems and thus commonalities were identified in the group. In general, the event was also emotional for the participants in a beautiful and healing way, as some very personal experiences were shared. It soon became noticeable that the workshop had to be dynamically adapted to the needs and requirements of the participants and could not be conducted in a stoic and rigid manner, as the focus was also on the elaboration of emotions. The private nature of the event and the opportunity to take refreshments and snacks contributed to its success.
In the end, there was a desire for more networking and empowerment meetings to follow. This is a goal the group has set for itself.
Finally, it should be emphasised that for reasons of protection, no names have been mentioned and no faces are shown in the pictures, as those affected unfortunately have to fear for their safety.
Text and Pictures: Atahan Demirel

In dieser Folge tauchen unsere Gastgeberinnen Neta-Paulina und Whitney mit unserem besonderen Gast und Expertin Dr. Semra Kızılkaya, einer Postdoc-Forscherin für deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Bielefeld, in die faszinierende Welt der Linguistik ein. Dr. Semra Kızılkaya, deren akademische Laufbahn sich über Berlin, London und Köln erstreckt, bringt eine Fülle von Wissen über soziale grammatikalische Variation mit.
Gemeinsam erforschen sie Sprachen als Identitätsmarker und diskutieren darüber, wie sprachliche und kulturelle Momente oft auf unerwartete Weise verschwimmen.
Seien Sie dabei, wenn wir entdecken, wie sich Sprache entwickelt, insbesondere in der heutigen pluralistischen Gesellschaft, und den Weg dieser lexikalischen Elemente erkunden, die Teil der Alltagssprache geworden sind. Besonderen Dank an unsere Gastsprecherin Dr. Semra Kızılkaya.
Jeden Monat erscheint eine neue Episode unseres Podcasts – bleiben Sie dran!
Intro: Carleigh Garcia | Sprecher*innen: Whitney Nosakhare, Neta-Paulina Wagner, Dr. Semra Kızılkaya | Audio-Edit: Kevin Nagel | Musik: Viktor Rosengrün ©2024 DialoguePerspectives
Am 1. & 2. Juni 2024 fand die Konferenz „Erinnerungsbedarf. Konferenz zum pluralen Erinnern in Migrationsgesellschaften“ in St. Pölten in Österreich statt, der erste europäische Kongress der Coalition for Pluralistic Public Discourse (CPPD) in Kooperation mit der Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur und dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST). Muhammet Ali Baş aus dem CPPD-Netzwerk kuratierte die Konferenz.
Wissenschaftler*innen, Künstler*innen und Aktivist*innen aus verschiedensten Communities diskutierten in Panels, Workshops und weiteren Formaten im Rahmen des Leitthemas »Memory Matters« zu Fragestellungen des kulturellen und politischen Gedenkens an rassistisch und antisemitisch motivierte Gewaltereignisse.
Anlässlich der Konferenz wurde am 1. Juni das Dynamic Memory Lab zum Thema „Codes of Memory in Sinti*- und Roma*-Communities“ auf dem Rathausplatz in St. Pölten gemeinsam mit dem Architekten Jan Bodenstein und dem Kuratur Hamze Bytyçi feierlich eröffnet. Die von Hamze Bytyçi kuratierte Ausstellung wurde durch regionale Perspektiven zu Roma* und Sinti* sowie Jenischen in Österreich aktualisiert und erweitert.
Über 40 erinnerungspolitische Akteur*innen und Mitglieder der CPPD aus 12 europäischen Ländern kamen im Rahmen der Konferenz zu einem Netzwerktreffen zusammen, um über unterschiedliche Erinnerungsbedarfe auf europäischer Ebene zu diskutieren sowie Ziele und nächste Schritte für die gemeinsame Arbeit festzulegen. Das Netzwerktreffen wurde von Vatan Ukaj moderiert.
CPPD-Kurator Max Czollek stellte in seiner Keynote Thesen zur Erinnerungskultur auf, die aktuelle erinnerungspolitische Herausforderungen durch die Instrumentalisierung von Erinnerung im Zuge des europaweit zunehmend stärker werdenden Rechtsrucks reflektierten. In der Podiumsdiskussion „Wessen Erinnerung fehlt, und wer kämpft für ihre Sichtbarmachung?“ sprach die Theaterwissenschaftlerin Darija Davidovic gemeinsam mit dem Lyriker und Journalisten Samuel Mago, der Pädagogin und Aktivistin Ayşe Güleç und dem Bildenden Künstler Philipp Gufler über Wege zu einer demokratischen Erinnerungskultur.
Am 2. Juni führte zunächst die Künstlerin Nina Prader einen Zine-Workshop durch, in der die Funktion von Zines als erinnerungspolitisches und gemeinschaftsbildendes Tool im partizipativen Prozess der Zine-Gestaltung im Zentrum standen. Der Architekt Jan Bodenstein sowie die postkoloniale Stadtforscherin Noa K. Ha führten die Teilnehmer*innen in einem Workshop zu Stadtgeschichte und Erinnerung in die Bedeutung und Notwendigkeit plural konzipierter Erinnerungsarchitekturen ein.
Auf dem anschließenden Podium diskutierten die Sozialpädagogin Eşim Karakuyu und Prof. Dr. Frederek Musall, Vorsitzender von DialoguePerpectives e.V, beide aus dem CPPD-Netzwerk, sowie der Vorsitzende der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus Derviş Hızarcı und die Künstlerin Sheri Avraham unter dem Titel „Es ist Zeit – lasst uns reden! Erinnerung bedarf Gespräch“ über die komplexen Herausforderungen und Polarisierungen in Deutschland und Österreich nach dem 7. Oktober/Krieg in Gaza. Das Panel wurde von Max Czollek moderiert.
Fotocredit: Felix Kubitza
Die Dringlichkeit, Erinnerungskulturen im europäischen Kontext zu entwickeln, war ein zentrales Thema der Konferenz „Erinnerungsbedarf. Konferenz zum pluralen Erinnern in Migrationsgesellschaften“. Eine der Hauptthesen dieser Konferenz war die Wichtigkeit der Förderung von Diversität und Inklusion. Plurale Erinnerungskulturen sind unerlässlich, um die vielfältigen Erfahrungen und Geschichten unterschiedlicher Communities in Europa anzuerkennen und sichtbar zu machen.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Notwendigkeit, das Vergessen zu verhindern. Diese Arbeit ist entscheidend, um aus der Vergangenheit zu lernen und ähnliche Fehler in der Zukunft zu vermeiden. In Anbetracht des zunehmenden Rechtsrucks in Europa ist es zudem wichtig, Erinnerungskulturen zu schaffen, die der Instrumentalisierung von Erinnerungen durch rechtspopulistische Bewegungen entgegenwirken. Plurale Erinnerungskulturen stärken die Werte der Demokratie und die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft gegenüber autoritären und diskriminierenden Tendenzen. Eine plurale, demokratische Erinnerungskultur, die auf Teilhabe und Mitbestimmung setzt, fördert eine aktive Bürgerschaft und trägt zur politischen Bildung bei.
Die Entwicklung plural konzipierter Erinnerungsarchitekturen in städtischen Räumen ist ebenfalls notwendig, um Orte des Gedenkens und der Reflexion zu schaffen, die die Vielfalt und die komplexen Geschichten der Stadtbewohner*innen widerspiegeln. In Workshops zur Stadtgeschichte und Erinnerung wurde die Bedeutung dieser architektonischen Konzepte betont. Darüber hinaus können künstlerische und kreative Ansätze, wie Zine-Workshops und Ausstellungen, neue Zugänge und Ausdrucksformen für kollektives und individuelles Erinnern eröffnen und so die Partizipation breiter Bevölkerungsgruppen fördern.
Erinnerungskulturen haben auch in laufenden Konflikten und Kriegen eine besondere Bedeutung. Die Art und Weise, wie wir aktuelle Ereignisse darstellen, welche Interpretationen wir vornehmen und welche Positionen wir beziehen, beeinflusst unser kollektives Gedächtnis und die Art, wie wir Geschichte erinnern. Angesichts von Leid und Trauer ist es insbesondere eine Perspektive der Empathie und Solidarität, die in Erinnerungskulturen widergespiegelt wird. Plurale Erinnerungskulturen können dadurch auch in der Gegenwart gegen Polarisierungen wirken.
Ein besonderes Highlight der Konferenz war das Dynamic Memory Lab, das diese Erkenntnisse aufgreift und weiterentwickelt. Es verdeutlicht, wie vielfältige Perspektiven und Ansätze in der Erinnerungsarbeit integriert werden können, um eine umfassende und inklusive Erinnerungskultur zu schaffen.
„Marseille – Religious Plurality at the Crossroads of a Multicultural City and National Laicism“
Eine Gruppe aktueller und ehemaliger Teilnehmer*innen von Dialogperspektiven reiste nach Marseille, Frankreich, um die Geschichte der Stadt und ihre aktuellen Herausforderungen, darunter Migration und soziale Fragen, zu erkunden. Ihre Reise zielte darauf ab, die Komplexität der sozialen und religiösen Landschaft Marseilles zu verstehen und half ihnen, über Themen wie Säkularismus und sozialen Zusammenhalt nachzudenken. Besuche in jüdischen, muslimischen und katholischen Gemeinden vermittelten differenzierte Einblicke in die religiöse Vielfalt Marseilles. Die Begegnungen mit den Menschen vor Ort boten unterschiedliche Perspektiven und hinterließen ein Gefühl der Sorge und Hoffnung auf ein pluralistisches Leben, ein respektvolles Zusammenleben und eine spürbare Solidarität in Marseille und Europa.
Impressions from our participants:
From 1 to 5 May 2024, we – a group of DialoguePerspectives Alumni – visited Marseille to collaboratively explore the city and engage with religious and civil society actors. Why choose Marseille? Marseille’s extensive history of migration intersects with current social challenges, including the reinvigorated debate on French secularism and the escalation of far-right movements and political entities in southern France. The city represents a microcosm of the broader social challenges confronting Europe. In the current European context, where religious diversity and coexistence are under threat, Marseille emerges as a pivotal location for examining the construction of pluralistic and democratic societies. The city is distinguished by its religious plurality, hosting Europe’s third-largest Jewish community and a myriad of Christian and Muslim denominations. This multi-religious landscape has profoundly influenced Marseille’s societal fabric. In designing our program, we lay a critical focus on the intersections of religion, migration, and queer identities, aiming to develop nuanced responses to the rising tide of right-wing politics.


We got a guided city tour through a Jewish lens, visited ‘Calem’, a queer Muslim community and association, and met with representatives of ‘D&J Arc-en-Ciel’, a queer Catholic organisation. Furthermore, we visited the Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) with a guided tour and experienced Marseille from a completely different sensory perspective with a ‘blind walk’. We talked about the city’s stark social disparity and segregation at L’Après-M, a former McDonald’s in Marseille’s Quartiers Nord, which was transformed into a „Restaurant Solidaire“ and community space by the occupation during the early Covid-19 lockdowns. We were able to go more into these subjects on our last day when we met with a criminal defense attorney. Specifically, we learned about his practice and how the legal system and its players address socio-economic injustice. Racism and Marseilles police violence were among the other subjects discussed.


The people we met as part of the programme shared their lived realities with us that would have been invisible through a touristic outside lens. They provided us with an astonishingly wide array of sometimes contradictory perspectives on this ever-changing city. In the end, they left us with a sense of worry and at the same time hope for a pluralistic life, modes of respectful coexistence, and tangible solidarity in Marseille and Europe.
Text & Pictures: Anile Tmava & Simon Stromer
Am 15. Mai 2024 lud PARTES zu einem interreligiösen Dialogforum nach Wien ein, um partizipative Ansätze zum Schutz von Gebets- und Kultstätten zu diskutieren. Dialogperspektiven nahm daran teil und tauschte sich intensiv über Polarisierung und Ursachen von Extremismus aus. Im Fokus standen extremistische Äußerungen und Gewaltandrohungen gegen Gebets- und Kultstätten sowie Dialogformate in unterschiedlichen Kontexten. Präventionsmaßnahmen und die Bedeutung angemessener Reaktionen wurden thematisiert. Religionsgemeinschaften, Institutionen und Dialogformate sind häufig Opfer von Gewalt und extremistischen Angriffen, was ihre Arbeit erheblich erschwert. Daher fand ein wertvoller Austausch zwischen Gemeinden, Verbänden und Institutionen statt, bei dem vorhandene Expertisen im Umgang mit extremistischen und polarisierenden Meinungen und Bedrohungen geteilt wurden. Besonders hervorgehoben wurde die Notwendigkeit ausreichender Ressourcen, um präventive Maßnahmen zu entwickeln und Extremismus wirksam zu bekämpfen.
Die Teilnehmer*innen betonten die Notwendigkeit, Religionsgemeinschaften und Dialogformate besonders zu schützen und in Präventionsmaßnahmen einzubeziehen, da sie häufig Ziel extremistischer Gewalt seien. Die Rolle der Religionsgemeinschaften und der Gesellschaft im Kampf gegen Extremismus wurde intensiv diskutiert. Religionsgemeinschaften können eine Schlüsselrolle bei der Prävention spielen, indem sie positive Botschaften der Toleranz und des Zusammenhalts verbreiten und gleichzeitig Ressentiments in den eigenen Reihen ansprechen und bearbeiten. Erfolgreiche Beispiele aus religiösen und zivilgesellschaftlichen Kontexten zeigen, wie effektiv Präventionsmaßnahmen auf kommunaler Ebene sein können. Diese Ansätze verdeutlichen, dass trotz der Bedrohung durch Extremismus wichtige Fortschritte möglich sind. Abschließend forderten die Teilnehmer*innen politische Unterstützung und notwendige Veränderungen, um effektive Maßnahmen gegen Extremismus zu fördern und den Schutz religiöser Gemeinschaften und Dialogformate zu gewährleisten.

Wir freuen uns, die DialoguePerspectives Decade Edition 2024 „Reflecting on the Past, Envisioning the Future: European Core Conflicts in a Time of Polycrisis“ anzukündigen und laden alle aktuellen und ehemaligen Dialogperspektiven-Teilnehmer*innen zur Bewerbung ein!
As we celebrate a decade of dialogue and cooperation through the DialoguePerspectives programme, we find ourselves at a pivotal moment in Europe’s history. The current convergence of crises underscores the imperative for collective expertise, insights, and perspectives on charting a path forward rooted in concrete action and practical solidarity within a pluralistic society. It is now more evident than ever that the role of religious and worldview communities in European civil society has been significantly underestimated. The importance of programmes such as DialoguePerspectives has never been greater. Precisely such programmes, which take a multi-perspective approach to conflicts and work on policies with a focus on impact, must now finally be strengthened so that their influence on global contexts increases.
We are all familiar with the current polycrisis, the convergence of multiple crises across Europe presents a daunting and intricate challenge. Attacks from right-wing factions on justice and democracy jeopardise the fundamental principles underpinning European nations, necessitating unified efforts to uphold the rule of law and safeguard democratic institutions. The proliferation of misinformation and disinformation exacerbates these challenges, eroding trust in institutions and undermining informed decision-making processes. Societal upheavals, including the renegotiated role of religions and worldviews and the resurgence of ethno-nationalism, pose significant threats to social cohesion and stability. Moreover, the additional challenges stemming from the attacks of 7th October, the conflict in Gaza, Russia’s ongoing aggression in Ukraine, the military tensions between Israel and Iran, and the global climate crisis compound the urgency of the situation.
In today’s interconnected world, the cumulative consequences of these crises highlight the pressing need for resilience within European societies. Instead of uniting to address these challenges, we witness their perpetuation and exacerbation, with polarisation seemingly encouraged and societal cohesion increasingly strained. Tackling these issues entails fostering inclusive societies that embrace diversity and promote tolerance, while also addressing the underlying economic and social grievances that fuel extremist ideologies. Navigating this complex landscape necessitates both short-term measures to mitigate immediate threats and long-term strategies to address systemic issues. International cooperation and solidarity within European society are indispensable in confronting these challenges and safeguarding the principles of democracy, justice, and human rights.
In light of these challenges, we are delighted to announce our conference „Reflecting on the Past, Envisioning the Future: European Core Conflicts in a Time of Polycrisis“. This event provides a platform for our esteemed alumni to contribute their wealth of experience to shaping the future trajectory of Europe and our programme. The imperative for sustainable social change and European cooperation has never been greater. This includes fostering socially oriented, forward-looking interfaith and interreligious dialogue that transcends the boundaries of religion, belief, and nationality.
Format:
Over the years, the participation of our alumni has been instrumental in fostering understanding and catalysing change within our and your communities. Your expertise is vital in navigating these complexities. We invite you to join us in this crucial endeavour – to share your insights, engage in critical analysis and collaborate on innovative impact-oriented solutions. Through a series of interactive sessions, workshops and networking opportunities, participants will delve into the core conflicts shaping Europe’s identity and development. From historical legacies to contemporary challenges, together we will unravel the complexities of Europe’s polycrisis and chart a course towards a more inclusive, resilient, and prosperous future.
Date and location:
4th – 7th November 2024
Berlin, Germany
Costs:
Travel expenses up to 100 € (national) and 300 € (international) and hotel costs up to 70 € per person per night will be reimbursed.
Application details:
We invite 60 former participants of DialoguePerspectives to take part in our “Reflecting the Past, Envisioning the Future: European Core Conflicts in a Time of Polycrisis” conference.
If you would like to participate, please submit your application via our application form here. The deadline for applications is 1st July 2024. Should you have any questions please contact us at: bewerbung@dialogperspektiven.de
We cannot wait to see you at our “Reflecting the Past, Envisioning the Future: European Core Conflicts in a Time of Polycrisis” conference and look forward to your application.
Call for Application Decade Edition 2024
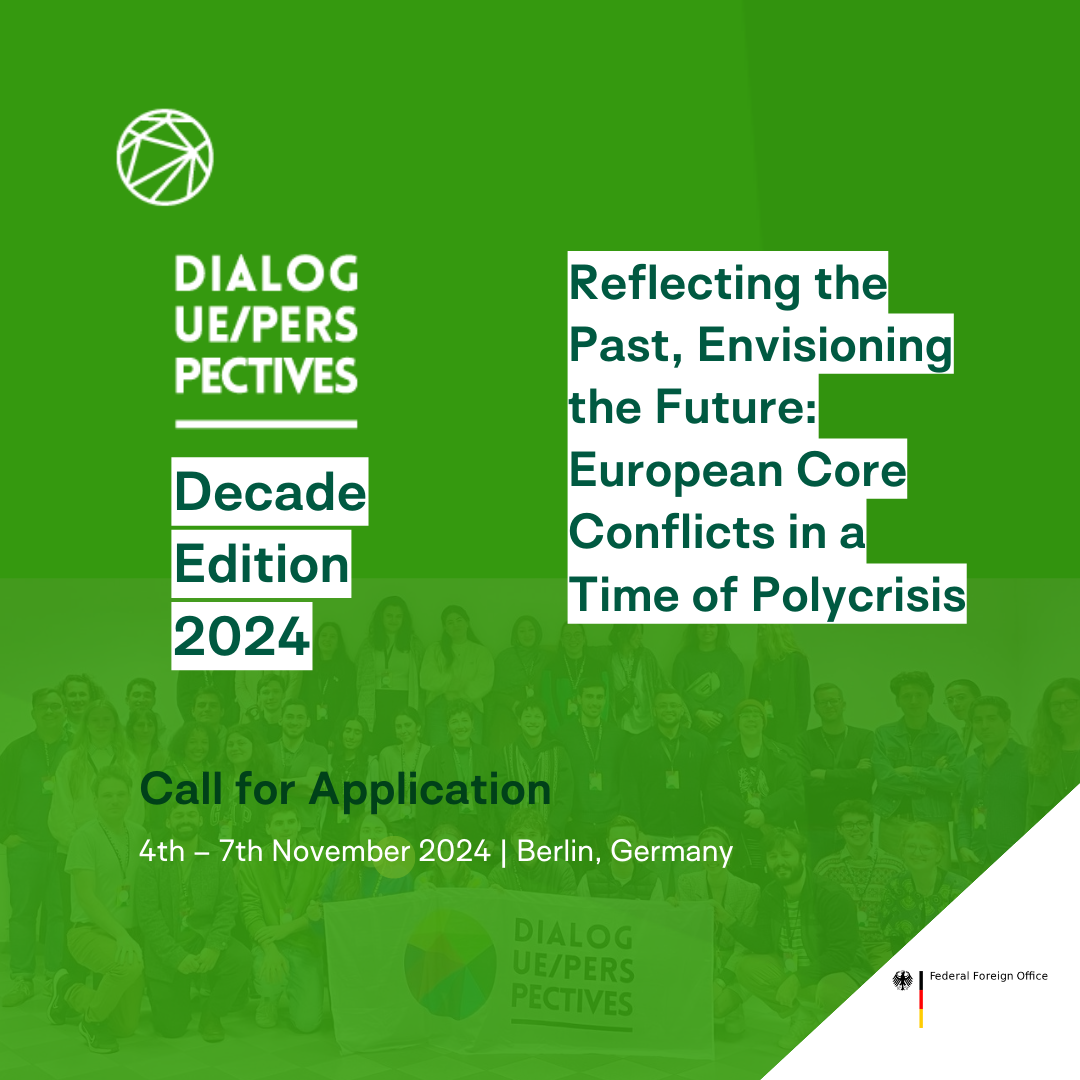
Vom 9. bis 11. April fanden die ersten Dagesh on Tour Qualifizierungstage 2024 für Künstler*innen und Bildungsreferent*innen statt. Im Rahmen der Qualifizierung kamen über 15 Honorarkräfte zusammen, um sich über ihre Erfahrungen mit Dagesh on Tour auszutauschen sowie neue Methoden im Umgang mit herausfordernden Workshopssituationen kennenzulernen.
Am ersten Tag setzten sich die Teilnehmer*innen mit kreativen Formaten der Kunstvermittlung auseinander. Eine Dagesh-Künstlerin leitete einen Workshop an und zeigte anhand ihrer erprobten Methoden wie es möglich ist, komplexe künstlerische Ausdrucksformen für Kinder und Jugendliche spielerisch erlebbar und vielseitig erfahrbar zu machen.
Aufbauend auf diesem Workshop erarbeiteten Bildungsreferent*innen und Künstler*innen im Laufe der nächsten Tage neue Methoden für die Vermittlung ihrer eigenen Kunstpraxis. Bei dem Format „Kunst in Duos“ entstanden neue Zugänge für Dagesh on Tour Workshops, die in den kommenden Monaten bei Workshopangeboten umgesetzt und evaluiert werden.
Eine Künstlerin sagte dazu: „Ich habe durch die Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Bildungsreferentin besser gelernt, wie ich über meine eigene Kunst zielgruppengerecht sprechen kann.“
Im Rahmen der Qualifizierung wurden auch anhand konkreter Situationen aus Dagesh on Tour Workshops kollegiale Fallberatungen durchgeführt. Durch gegenseitige Beratung konnten neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten entstehen. Zudem begrüßten wir Marina Chernivsky von Ofek e.V. Im Mittelpunkt des Austauschs stand der Umgang mit Antisemitismus und der Schutz der Künstler*innen und Bildungsreferent*innen sowie der Teilnehmenden bei Dagesh on Tour Workshops.
„Der Austausch mit Marina Chernivsky war berührend, empowernd und motivierend“ – so eine unserer Bildungsreferentin.
Außerdem fand ein Workshop mit Referent*innen von Culture Interactives e.V. statt. Mithilfe der beiden Expert*innen erarbeitete die Gruppe Strategien für den Umgang mit rechtsextremen Äußerungen im Rahmen der Bildungsarbeit. Zudem gab es an allen Tagen viel Zeit und Raum für Besprechungen, offene Fragen sowie für Feedback und Ausblick für die kommenden Monate.
Am 10. April fand abends außerdem ein Dagesh-Netzwerktreffen statt: über 30 Dagesh-Künstler*innen kamen zusammen und sprachen in informeller Runde über ihre laufenden Projekte, lernten neue Kolleg*innen kennen und berichteten von neuen Projektideen sowie aktuelle Herausforderungen.
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für den intensiven und bereichernden Austausch!
Photo credit: Elena Krasnokutskaya, © Dagesh, 2022
Alumni und Teilnehmer*innen von DialoguePerspectives aufgepasst: Jetzt bewerben für den diesjährigen European Leadership Workshop: „Navigating the Confluence of Real-Life Crisis and Digital Democracy“ in Karlsruhe.
Mehr zum Event:
In today’s turbulent times, multiple crises have left politics and society in a perpetual state of emergency. The digital realm has become a battleground of polarized views and widespread misinformation, making online navigation challenging. Despite advances in information technology enhancing communication accessibility, platforms like Facebook and TikTok also pose a threat to democratic systems due to issues like misinformation and biased algorithms. While the internet has fostered connectivity, it has also introduced challenges such as hate speech and surveillance, undermining democratic ideals. Profit-driven social media platforms often prioritize emotionally charged content, exacerbating the spread of misinformation.
As the digital world increasingly impacts real-life events, exploring digital democratic participation is vital. The European Leadership Workshop addresses these issues through interactive sessions, enhancing skills in critical thinking, digital literacy, and strategic communication to navigate the complexities of the digital age effectively.
From fostering critical thinking to enhancing digital literacy and strategic communication, our workshop promises to empower you to thrive in this ever-evolving environment.
The application is open to DialoguePerspectives’ alumni and participants! If you would like to participate, please send us an e-mail with a short letter of motivation to elw@dialogperspektiven.de. The deadline for applications is 30 May 2024.

Wir freuen uns dieses Jahr mit unseren Partnern der Jüdischen Woche Dresden zusammenarbeiten zu dürfen, um zeitgenössischen jüdischen Aktivismus, Kunst und Kultur in der sächsischen Hauptstadt zu diskutieren.
Am 15-16. April präsentiert die Jüdische Woche Dresden das Symposium Jüdische Jetzt. Die Bedeutung jüdischer Kultur für eine demokratische Gesellschaft.
„Unser Anliegen ist es, über eine lebendige jüdische Kultur nachzudenken und gemeinsam Antworten auf Fragen zu finden wie: Welchen Stellenwert hat die jüdische Kultur innerhalb der gesamten Kulturlandschaft? Wie ist es möglich, positive Erfahrungsräume für jüdische Themen zu schaffen? Was können wir aus den Erfahrungen von anderen lernen und wie können wir uns gegenseitig bereichern?“
Direkt nach der Eröffnung des Symposiums stehen spannende Themen zur Vermittlung jüdischer Thematiken u.a. zu Herausforderungen und Chancen bei jüdischen Kulturveranstaltungen im deutschen Kontext mit Lea von Haselberg und dem Dagesh-Kurator Daniel Laufer auf dem Programm. Am Nachmittag führen unter anderem Expert*innen aus dem Dagesh-Netzwerk, darunter Riv von radikal_jüdisch und Textilkünstlerin Adi Liraz Workshops zu vielfältigen Themen durch.
Am Dienstag geht es weiter mit Dagesh-Referent*innen Klarina S. Akselrud und Caroline Riggert, die über geeignete Formate für die Vermittlung jüdischer Themen sprechen werden.

Hier geht es zum Programm.
Die Veranstaltung findet in Kulturrathaus,Königstr. 15, 01097 Dresden statt, eine Anmeldung bis 8. April 2024 ist notwendig.
Siehe dazu: juedische-woche-dresden.de
Foto: Dagesh, © Phil Vetter, 2021
DialoguePerspectives e.V. trauert um Henri Vogel. Henri war ehemaliger Teilnehmer des Dialogperspektiven-Programms, Kollege im Team, aktives Vereinsmitglied, und nicht zuletzt ein Freund.
Henris zugewandte, warmherzige und lebensfrohe Art bereicherte nicht nur unsere Arbeit ungemein, sondern hinterließ bleibende Spuren bei allen, die das Glück hatten, Henri kennenzulernen. Für seine Überzeugungen hat sich Henri mit Kraft und Entschlossenheit eingesetzt, und dabei doch immer Empathie, Freude am Dialog und das Voneinander-Lernen gelebt.
Von Henri durften wir viel lernen. Nicht nur zu seinen Forschungsschwerpunkten, den Diskursen um Gender, nationale Identitäten und Schöpfungsgeschichten. Wir lernten von Henri immer wieder auch Menschlichkeit, Durchhaltevermögen, den Wert von Freundschaft, und wie man sich immer wieder am Leben erfreuen kann. Das Abschiednehmen von einem Menschen, der nicht nur unsere Arbeit begleitet hat, sondern auch uns und viele andere im Verein, fällt uns unheimlich schwer. Henri wird uns sehr fehlen.
Unsere Gedanken sind insbesondere bei Henris Ehemann und unserem Kollegen, Johannes Vogel, bei seiner Herkunfts- und Wahlfamilie, seinen Freund*innen, sowie bei allen, die ihn kennenlernen durften.
Um an das Vermächtnis von Henri Vogel als engagierten Transaktivisten und Mitglied von DialoguePerspectives e.V. zu erinnern, richten wir das Henri-Vogel-Stipendium ein. Henris selbstloses Engagement für die Unterstützung von trans Personen innerhalb von Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften inspirierte uns zur Schaffung dieses Stipendiums. Das Henri-Vogel-Stipendium zielt darauf ab, junge Wissenschaftler*innen, die sich als trans identifizieren, zu befähigen, zu Rechten von trans Personen zu forschen und damit Henris Vision für positive Veränderungen der Gesellschaft weiterzuführen. Das Stipendium richtet sich an trans Personen, die Forschung an der Schnittstelle von Trans-Rechten und Glaubens-/Weltanschauungsgemeinschaften betreiben, und ist offen für Wissenschaftler*innen aus allen zum Forschungsschwerpunkt passenden akademischen Disziplinen.
Weitere Informationen zum Stipendium finden sich hier: Henri-Vogel-Stipendium | Dialogueperspectives e.V.
Der Vorstand von DialoguePerspectives e.V.
Frederek Musall, Hannan Salamat, Alexander Graeff und Maximiliane Linde
Abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter!